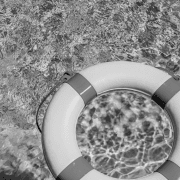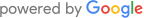Mit seiner Entscheidung vom 06.03.2015, Aktenzeichen 11 U 222/13 (Vorinstanz LG Hamburg, Kammer 13 für Handelssachen, vom 28. Februar 2013, Geschäfts-Nr. 413 HKO 40/12) macht das OLG Hamburg Ausführungen zur Haftung des Vorstands und Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit verbotswidrigen Zahlungen auf debitorisch geführte Konten und äußert sich gleichzeitig über die Auswirkung einer Globalzession auf die Verbotswidrigkeit von Zahlungen als solche.
Globalzession verhindert Schmälerung der Masse
Im Hinblick auf die Verbotswidrigkeit einzelner Zahlungen hält das OLG fest, dass der Einzug von Forderungen auf ein debitorisch geführtes Konto dann nicht zu einer Masseschmälerung bei der insolvenzreifen Gesellschaft führt, wenn diese Forderungen von einer Globalabtretung erfasst werden.
Dem klagenden Insolvenzverwalter sei zwar insoweit zu folgen, als dass für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung der Gesellschaft die Entgegennahme von Zahlungen auf ein debitorisch geführtes Konto eine verbotene Zahlung im Sinne des § 93 Abs. 3 Satz 1 [a.F.] AktG darstellen kann. Dies rechtfertige sich daraus, dass durch einen Zahlungseingang auf einem debitorischen Konto das Aktivvermögen der Gesellschaft zu Lasten ihrer Gläubigergesamtheit (und zum Vorteil der Bank) in gleicher Weise geschmälert wird wie bei einer Auszahlung aus dem Barvermögen der Gesellschaft In beiden Fällen wird der Insolvenzmasse zugunsten der Befriedigung eines Gläubigers ein Betrag entzogen, der anderenfalls zur (teilweisen) Befriedigung aller Insolvenzgläubiger zur Verfügung stünde. Demgegenüber sei vorliegend aber davon auszugehen, dass die Insolvenzmasse durch die klagegegenständlichen Einzahlungen auf die betreffenden Konten der Schuldnerin nicht geschmälert worden ist. Sämtliche Forderungen gegenüber Drittschuldnern der Schuldnerin waren nämlich bereits durch eine Globalabtretungsvereinbarung an eine (kreditgebende) Bank abgetreten, standen der Schuldnerin hiernach rechtlich und mit Rücksicht auf deren gegenüber der Bank bestehende Verbindlichkeiten auch wirtschaftlich nicht mehr zu und konnten damit schon vor den jeweiligen Zahlungsvorgängen nicht mehr Bestandteil des der Verpflichtung zum Masseerhalt unterliegenden Vermögens der Schuldnerin sein.
Hier die Entscheidung im Volltext:
OLG Hamburg, Urteil vom 06.03.2015, Aktenzeichen 11 U 222/13
Tenor
- Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Kammer 13 für Handelssachen, vom 28. Februar 2013, Geschäfts-Nr. 413 HKO 40/12, wird zurückgewiesen.
- Der Kläger hat die Kosten der Berufung zu tragen.
- Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leisten.
- Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
I.
Wegen des erstinstanzlichen Sach- und Streitstands wird gemäß § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen.
Ergänzend hierzu wird festgestellt:
Der Kläger nimmt die Beklagten als Vorstände und Aufsichtsräte der S. AG (im Folgenden: die Schuldnerin) auf die Erstattung von Einzahlungen auf zwei debitorisch geführte Bankkonten der Schuldnerin in Anspruch, die nach der von ihm behaupteten Insolvenzreife der Schuldnerin dort eingegangen sind.
Die im Bereich des Imports und Handels mit Möbeln und Wohnaccessoires tätige Schuldnerin, die über ein Grundkapital von DM 500.000,00 verfügt und zuletzt zwölf Mitarbeiter beschäftigte, unterhielt Bankverbindungen mit der Sparkasse H. und der V-Bank. Im Rahmen ihrer Geschäftsverbindung zur V-Bank kam es im Anschluss an entsprechende vorangegangene Vereinbarungen vom 30. Juli 1993 und vom 13. Juli 1995 am 26. Mai 2005 zum Abschluss einer Globalabtretungsvereinbarung (Anlagen B 1+2/3 = B 3.2 = B 1), durch die die Schuldnerin sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus dem Geschäftsverkehr an die V-Bank abtrat. Die Beklagten zu 1. und 2. hatten sich nach der Behauptung des Klägers darüber hinaus in Höhe von bis zu € 689.000,00 für die Forderungen der V-Bank gegenüber der Schuldnerin ebenso verbürgt wie deren Ehefrauen, bei denen es sich um die beiden alleinigen Aktionäre der Schuldnerin handelt.
Nach der Behauptung des Klägers erfolgten in der Zeit vom 1. Februar bis zum 9. August 2007 auf dem durchgehend debitorisch geführten Konto der Schuldnerin bei der Sparkasse H. Zahlungseingänge in Höhe von insgesamt € 346.631,06. Auf dem ebenfalls durchgehend debitorisch geführten Konto der Schuldnerin bei der V-Bank erfolgten nach der Behauptung des Klägers in der Zeit vom 1. Februar bis zum 12. September 2007 Zahlungseingänge in Höhe von insgesamt € 988.477,99.
Am 10. August 2007 beantragten die Beklagten zu 1. und 2., die Vorstände der Schuldnerin, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über deren Vermögen. Das Insolvenzverfahren wurde nachfolgend am 13. September 2007 unter gleichzeitiger Bestellung des Klägers zum Insolvenzverwalter eröffnet. Mit Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 13. August 2007 (Anlage B 3 = B 5/9) war der Kläger zuvor zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden.
Der Kläger hat gegen die Beklagten zu 1., 2., 4. und 5. am 25. Februar 2012 und gegen den Beklagten zu 3. am 28. Februar 2012 Klage erhoben, mit der er die Beklagten in Höhe von insgesamt € 1.335.109,05 gesamtschuldnerisch auf die Erstattung der nach seiner Behauptung seit dem 1. Februar 2007 auf den beiden Konten der Schuldnerin bei der Sparkasse H. und bei der V-Bank eingegangenen Zahlungen in Anspruch nimmt.
Der Kläger hat behauptet, die Schuldnerin sei bereits spätestens seit dem Jahr 2006, jedenfalls aber seit dem 1. Februar 2007 zahlungsunfähig und überschuldet gewesen. Die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin habe sich nach dem Ergebnis der Auswertung der Insolvenztabelle (Anlage K 1) schon daraus ergeben, dass seit dem 1. Januar bzw. seit dem 1. Februar 2007 Verbindlichkeiten der Schuldnerin in Höhe von € 52.929,87 bzw. in Höhe von € 63.401,23 fällig gewesen seien, die bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin nicht mehr erfüllt worden seien. Diese Verbindlichkeiten der Schuldnerin seien im Insolvenzverfahren auch bereits, was also solches unstreitig gewesen ist, in Höhe von € 44.341,77 festgestellt worden.
Der Kläger hat die von ihm geltend gemachte Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin darüber hinaus auch aus offenen Verbindlichkeiten der Schuldnerin gegenüber deren Vermieterin, der A. KG, aus der Anmietung von Garagencontainern hergeleitet. Hieraus hätten sich ausweislich eines Schreibens der Vermieterin vom 7. Februar 2007 (Anlage K 2) per 1. Februar 2007 offene Verbindlichkeiten der Schuldnerin in Höhe von weiteren € 25.000,00 ergeben. Auch wenn davon auszugehen sein sollte, dass die seitens der Schuldnerin insoweit für die Jahre seit 2002 geschuldeten Mietzahlungen von beiden Vertragsparteien schlicht vergessen worden und erst Anfang 2007 wieder in Erinnerung gelangt seien, so sei der Schuldnerin eine Gelegenheit zur ratenweisen Erfüllung dieser Verbindlichkeiten im Februar 2007 doch lediglich deshalb eingeräumt worden, weil sie gegenüber der Vermieterin ausdrücklich erklärt habe, den Rückstand nicht sogleich erfüllen und in dieser Höhe auch nicht binnen drei Wochen Kredit erlangen zu können, was wiederum auf die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin zurückweise.
Die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin ergebe sich zudem aber auch noch daraus, dass ausweislich eines Mahnschreibens der Vermieterin vom 23. Mai 2007 (Anlage K 2a) die für die Geschäftsräume insoweit geschuldete laufende Miete für April 2007 in Höhe von € 11.778,70 bis dahin noch nicht gezahlt worden sei und sich unter Berücksichtigung auch der beiden bereits für April und Mai 2006 in Höhe von € 11.778,70 und € 12.312,49 rückständig gebliebenen Mieten sowie der in Höhe von weiteren € 5.911,62 aus der Betriebskostenabrechnung für 2005 ausstehenden Restforderung ein Gesamtbetrag offener Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt € 61.443,61 ergeben habe. Die Schuldnerin habe sich insoweit über Monate die Stundung ihrer Verbindlichkeiten erzwungen. Eine Ratenzahlungsvereinbarung sei auch in der Folgezeit nicht mehr zustande gekommen, die Schuldnerin habe trotz Aufforderungen der Vermieterin schlicht nicht gezahlt.
Ferner hat der Kläger behauptet, die Schuldnerin habe sich gegenüber einer weiteren Gläubigerin, der M. GmbH, in einer – seitens des Klägers allerdings nicht eingereichten – E-Mail vom 11. April 2007 ebenfalls dahin geäußert, offene Forderungen dieser Gläubigerin in Höhe von € 42.425,44 nur im Wege der Ratenzahlung erfüllen zu können. Nur auf der Grundlage dieser eigenen Erklärung der Schuldnerin sei nachfolgend am 20. April 2007 eine entsprechende Ratenzahlungsvereinbarung (Anlagen K 3 und K 4) tatsächlich zustande gekommen. Die dieser Vereinbarung zu Grunde liegende Erklärung der Schuldnerin, zum sofortigen Rechnungsausgleich nicht in der Lage zu sein, lasse wiederum den Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin zu. Namentlich sei eine der in diese Ratenzahlungsvereinbarung einbezogenen Rechnungen der M. GmbH vom 27. Februar 2007 über € 32.712,15 bereits seit diesem Tag fällig gewesen und von der Schuldnerin gerade nicht zeitnah ausgeglichen worden. Die betreffende Ratenzahlungsvereinbarung sei zudem nachfolgend daran gescheitert, dass die Schuldnerin die am 15. Juli 2007 in Höhe von € 12.425,44 fällig gewordene letzte Rate schlicht nicht gezahlt habe.
Den gleichen Rückschluss auf die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin lasse schließlich auch die E-Mail-Korrespondenz der Schuldnerin mit einer Firma P. GmbH vom 11. Juni 2007 zu (Anlage K 5). Die Schuldnerin habe auch gegenüber dieser Gläubigerin um Ratenzahlung nachgesucht und hierdurch wiederum zumindest konkludent zu erkennen gegeben, nicht sämtliche dieser Gläubigerin gegenüber per 30. April 2007 in Höhe von € 28.498,57 bestehenden Verbindlichkeiten begleichen zu können.
Der Kläger hat darüber hinaus behauptet, die Schuldnerin sei bereits seit dem 31. Januar 2006 auch überschuldet gewesen. Hierfür hat der Kläger sich auf den am 16. Dezember 2006 erstellten Prüfbericht (Anlage K 6) zu dem auf diesen Stichtag erstellten Jahresabschluss der Schuldnerin bezogen, der die rückständigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin aus den in den Vorjahren nicht gezahlten Mieten für Garagencontainer nicht ausgewiesen habe und auf dessen Grundlage schon deshalb eine Überschuldung der Schuldnerin im Umfang von zumindest € 23.344,17 festzustellen sei. Darüber hinaus sei aber auch davon auszugehen, dass die Daten bezüglich des als Aktiva ausgewiesenen Bestands an lagernder Ware fehlerhaft seien, zumindest seien diese Wertansätze anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses nicht gesondert überprüft worden. Es sei deshalb von einem Wertabschlag auf die Warenvorräte in Höhe von 10 % auszugehen, wodurch sich die bei der Schuldnerin eingetretene Überschuldung noch vergrößert habe.
Für den klagegegenständlichen Zeitraum ab dem 1. Februar 2007 ergebe sich die Überschuldung der Schuldnerin darüber hinaus auch aus einer von ihm selbst am 21. August 2007 erstellten „Arbeits-Bilanz“ zum 31. Januar 2007 (Anlage K 7), die wiederum nicht die rückständigen Verbindlichkeiten aus den Garagenmieten und zudem einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Verlust in Höhe von € 42.101,11 ausgewiesen habe. Tatsächlich hätte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sich unter Berücksichtigung eines weiteren neuerlichen Jahresfehlbetrags von € 180.232,52 allerdings auf € 166.091,52 belaufen müssen. Über stille Reserven habe die Schuldnerin nicht verfügt, namentlich habe sie kein eigenes Grundvermögen besessen. Für die von ihm geltend gemachte Überschuldung der Schuldnerin hat der Kläger sich ferner auf ein Sanierungskonzept der Unternehmensberatung E. vom 3. Juli 2009 (Anlage K 8) bezogen, in dem per 31. Januar 2007 ein negatives Kapital der Schuldnerin in Höhe von € 179.000,00 ausgewiesen worden sei. Auch mit Blick auf die Annahmen dieses Sanierungskonzepts gelte aber, dass sich wegen eines Wertansatzes für das Warenlager der Schuldnerin in zutreffender Höhe von höchstens € 500.000,00 in einem Überschuldungsstatus eine Überschuldung der Schuldnerin in Höhe von mindestens € 527.450,05 hätte ergeben müssen. Schließlich folge auch aus einer ebenfalls am 21. August 2007 von ihm erstellten „Arbeits-Bilanz“ zum 30. April 2007 (Anlage K 9) ein weiterer Fehlbetrag der Schuldnerin für das I. Quartal 2007 in Höhe von € 148.661,63.
Der Kläger hat gemeint, die Beklagten zu 1. und 2. seien in Anbetracht der Krise, in der sich die Schuldnerin bereits spätestens seit dem Jahr 2006 befunden habe, zur laufenden Prüfung der Insolvenzreife der Schuldnerin verpflichtet gewesen und hätten nach Eintritt der Insolvenzreife dafür Sorge tragen müssen, dass Zahlungseingänge der Schuldnerin nicht auf die debitorischen Konten bei der Sparkasse H. und der V-Bank vereinnahmt worden und so lediglich diesen beiden Gläubigerinnen zugutegekommen wären. Die gleiche Verpflichtung habe auch den Beklagten zu 3. bis 5. als den Aufsichtsräten der Schuldnerin oblegen. Diese hätten schon aufgrund des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses der Schuldnerin zum 31. Januar 2006 ebenfalls von der Unternehmenskrise Kenntnis gehabt und hiernach die Überwachung der Tätigkeit des Vorstands steigern müssen und dem Vorstand auch außerplanmäßige Berichtspflichten aufgeben müssen.
Der Kläger hat beantragt,
die Beklagten zu 1. bis 5. werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger € 1.335.109,05 nebst 5 Prozentpunkten Zinsen p.a. über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagten zu 1. und 2. haben behauptet, die Vermieterin der Geschäftsräume habe die im Jahr 2006 ausstehend gebliebenen zwei Monatsmieten, zu denen es im Übrigen im Zusammenhang mit Wassereintritten im Lager der Schuldnerin gekommen sei, ebenso wenig ernsthaft eingefordert wie dies auch betreffend die Mieten für Garagencontainer der Fall gewesen sei, die zuvor vergessen und erst im Jahr 2007 als offen festgestellt worden seien und zu deren ratierlicher Begleichung die Vermieterin sogleich ebenso bereit gewesen sei wie sogar auch noch zu einer per 1. Februar 2007 erfolgten Erweiterung der Mietfläche (vgl. Anlage B 1+2/11 = B 15).
Soweit der Kläger sich zur Begründung der Zahlungseinstellung der Schuldnerin auf Verbindlichkeiten gegenüber einer H. a/s bezogen hat, haben die Beklagten zu 1. und 2. behauptet, innerhalb der mit dieser seit 2005 bestehenden Geschäftsverbindung seien Warenlieferungen nicht aufgrund von Wareneinkäufen der Schuldnerin, sondern vielmehr zum Aufbau eines eigenen Warenbestands der H. a/s erfolgt, der von der Schuldnerin dann lediglich auf Provisionsbasis habe veräußert werden sollen. Hiernach sei von fälligen Zahlungsansprüchen zu den seitens des Klägers geltend gemachten Zeitpunkten nicht auszugehen, es seien vielmehr Verhandlungen über die gegenseitigen Forderungen und deren Fälligkeiten geführt worden, was sich auch aus der E-Mail-Korrespondenz mit der H. a/s vom 29. Juni und 2. Juli 2007 (Anlage B 1+2/4) ergebe. Hierin habe die H. a/s eine aktuelle Berechnung der gegenüber der Schuldnerin bestehenden Forderungen angekündigt und zugleich deren ratenweiser Abzahlung zugestimmt. Die sich hiernach ergebende Gesamtforderung in Höhe von € 10.989,26 sei dann Gegenstand einer Zahlungsvereinbarung geworden, die erst beginnend mit dem 1. September 2007 monatliche Zahlungen der Schuldnerin in Höhe von lediglich € 1.000,00 vorgesehen habe (Anlage B 1+2/6).
Hinsichtlich der Forderungen der P. GmbH gegenüber der Schuldnerin sei es, so haben die Beklagten zu 1. und 2. behauptet, so, dass dieses Unternehmen im Zuge der Übernahme des Lagerbestandes eines anderen Unternehmens beauftragt worden sei. Dieser Auftrag sei unsachgemäß ausgeführt worden, weshalb sich auch Differenzen über die Höhe der geschuldeten Vergütung ergeben hätten, die der Beklagte zu 1. in einem Aktenvermerk vom 5. September 2007 (Anlage B 1+2/8) festgehalten habe. Dies sei auch der Hintergrund für die per E-Mail geführte Korrespondenz über eine Ratenzahlung gewesen, ein Rückschluss auf eine etwaige Zahlungsunfähigkeit lasse sich hieraus nicht entnehmen. Von einer Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin bereits vor dem Zeitpunkt der Stellung des Insolvenzantrags sei auch unter Berücksichtigung einer am 21. Mai 2007 erstellten Cash-Flow-Berechnung (Anlage B 1+2/9 = B 5/6) nicht auszugehen, die bis einschließlich Mai 2007 eine ausreichende Liquidität der Schuldnerin ausgewiesen habe.
Von einer Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin sei, so haben die Beklagten zu 1. und 2. weiter behauptet, auch deshalb nicht auszugehen, weil, was als solches unstreitig gewesen ist, der Schuldnerin am 31. Januar 2007 seitens eines Privatinvestors ein ungesichertes Darlehen in Höhe von € 100.000,00 zur Verfügung gestellt worden sei.
Auch von einer Überschuldung der Schuldnerin sei nicht auszugehen, diese habe sich schon gar nicht aus den über Jahre unbeglichen gebliebenen Mieten für die Garagencontainer ergeben können, weil diese zum Zeitpunkt der diese betreffenden Rückzahlungsvereinbarung teilweise sogar schon verjährt gewesen und erst mit dieser Vereinbarung auf eine neue vertragliche Grundlage gestellt worden seien. Die Behauptung des Klägers, der Warenbestand der Schuldnerin sei mit nicht mehr als € 500.000,00 anzusetzen gewesen, stünde im Übrigen im Widerspruch zu dem im Rahmen des Insolvenzverfahrens seitens des Klägers erstellten Gutachten, in dem dieser, was als solches unstreitig gewesen ist, allein für den Lagerbestand der Schuldnerin bei der P. GmbH bereits einen Einstandswert in Höhe von € 493.000,00 zu Grunde gelegt habe. Unter Berücksichtigung der als solche ebenfalls unstreitigen Rangrücktrittserklärungen unter anderem der beiden Aktionärinnen der Schuldnerin, wie diese sich dem geprüften Jahresabschluss per 31. Januar 2006 im Umfang von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von zumindest € 328.000,00 entnehmen ließen, sei von einer Überschuldung auch nicht mit Blick auf den vom Kläger behaupteten Verlustvortrag in Höhe von € 297.747,05 auszugehen, das wirtschaftliche Eigenkapital der Schuldnerin sei vielmehr zu jeder Zeit positiv gewesen. Dies gelte auch mit Blick auf die sog. Arbeits-Bilanzen des Klägers zum 31. Januar und 30. April 2007.
Die Beklagten zu 3. bis 5. haben im Hinblick auf die seitens des Klägers behauptete Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin darüber hinaus behauptet, dass ihnen von angeblichen Zahlungsrückständen gegenüber dem Vermieter nichts bekannt gewesen sei, die laufenden Mietzahlungen für die Garagencontainer seien seit dem Jahr 2002 zudem schlicht nicht mehr bedacht und dementsprechend auch nicht ernstlich eingefordert worden, bei der nachfolgend im Jahr 2007 vereinbarten Ratenzahlung habe es sich um eine einvernehmliche Stundungsabrede gehandelt. Es sei dem Aufsichtsrat durch die Beklagten zu 1. und 2. auch im Zeitraum seit Februar 2007 beständig vermittelt worden, dass Zahlungsschwierigkeiten nicht bestünden, gerade das Verhältnis zur Vermieterin sich bestens gestalte und mit dieser Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen geschlossen worden seien bzw. auch Mietforderungen mit aus einem Wasserschaden stammenden Ansprüchen der Schuldnerin verrechnet werden sollten. Im Übrigen habe es der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin entgegengestanden, dass diese noch im Januar 2007 ein privates Darlehen eines potentiellen Investors in Höhe von € 100.000,00 vereinnahmt habe, wodurch nach den damaligen Angaben der Beklagten zu 1. und 2. in der Folgezeit sämtliche fälligen Verbindlichkeiten der Schuldnerin hätten erfüllt werden können. Sofern dies tatsächlich nicht geschehen sein sollte, sei dies nicht auf die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin, sondern vielmehr auf die Entscheidung des Vorstands über die Verwendung dieses neuen Kapitals zurückzuführen. Die gegenüber der Vermieterin angeblich bereits für April und Mai 2006 rückständig gebliebenen Mieten seien, was als solches unstreitig gewesen ist, bis auf einen Rest für Mai 2006 überdies gar nicht als Insolvenzforderung angemeldet worden und dementsprechend noch vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens weitestgehend beglichen worden.
Auch die Beklagten zu 3. bis 5. sind der Behauptung des Klägers hinsichtlich einer spätestens zum 1. Februar 2007 eingetretenen Überschuldung der Schuldnerin entgegengetreten. Mit Blick auf die im – unstreitigen – Umfang von € 328.000,00 erklärten Rangrücktritte habe der in Höhe von € 179.000,00 negative bilanzielle Eigenkapitalausweis per 31. Januar 2007 die insolvenzrechtliche Überschuldung der Schuldnerin nicht begründen können, vielmehr habe zu diesem Stichtag noch ein wirtschaftliches Eigenkapital der Schuldnerin in Höhe von € 149.000,00 bestanden. Es seien von den Beklagten zu 1. und 2. im Zeitraum ab Februar 2007 zudem auch keine Tatsachen berichtet worden, die auf eine Überschuldung der Schuldnerin hätten schließen lassen können. Es sei vielmehr in der gesamten Zeit vom Sommer 2006 bis zum Sommer 2007 an einer Neuausrichtung der Unternehmensstrategie gearbeitet worden, ohne dass während dieses Zeitraums von irgendwelchen Zahlungsschwierigkeiten oder einer akut drohenden Überschuldung die Rede gewesen sei. Zu einer derartigen Neuausrichtung habe der Vorstand der Schuldnerin sich unter anderem auch auf einer Aufsichtsratssitzung vom 28. November 2006 (Protokoll als Anlage B 3.4 = B 4 = B 5/3) ausdrücklich geäußert, in der hinsichtlich aufgelaufener Verluste auf den Einstieg eines möglichen Investors mit einem in Rede stehenden Investitionsvolumen von € 200.000,00 als Lösungsansatz Bezug genommen worden sei.
Die Beklagten zu 3. bis 5. haben ebenfalls geltend gemacht, dass eine etwaige Insolvenzreife der Schuldnerin für sie jedenfalls auch nicht erkennbar gewesen sei, namentlich hätten sie auch keine Kenntnis davon gehabt, dass die Schuldnerin fällige Verbindlichkeiten angeblich nicht beglichen habe. Auf der Aufsichtsratssitzung vom 28. November 2006 habe der Beklagte zu 1. vielmehr ausdrücklich erklärt, dass trotz aufgelaufener Verluste keine Anhaltspunkte für eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vorlägen. Mit einem Bericht vom 5. Dezember 2006 (Anlage B 3.5 = B 5 = B 5/4) habe der Vorstand dann zudem dargestellt, dass sich die Schuldnerin wieder auf einem positiven Kurs befunden habe, die Prüfungshandlungen des Aufsichtsrats seien auch in der Folgezeit weiter intensiviert worden. Auf einer weiteren Aufsichtsratssitzung vom 27. März 2007 (Protokoll als Anlage B 3.6 = B 7 = B 5/3) sei seitens des Vorstands zwar ein Verlust in einer Größenordnung von € 160.000,00 dargestellt worden, gleichwohl sei im Hinblick auf das Darlehen des bereit stehenden Investors, der sich zudem mit weiteren € 100.000,00 als Aktionär habe beteiligen wollen, schon eine deutliche Entspannung der Liquiditätslage zu verzeichnen gewesen, zumal der für Februar 2007 geplante Umsatz sogar überschritten worden sei.
Der Aufsichtsrat habe gegenüber dem Vorstand unter anderem deutlich gemacht, dass er laufend monatlich über die aktuellen Zahlen unterrichtet werden wolle. Im Rahmen einer weiteren Aufsichtsratssitzung bereits am 29. Mai 2007 (Protokoll als Anlage B 3.7 = B 8 = B 5/3) habe der Vorstand dann von Umsatzsteigerungen berichtet, gleichwohl eingetretene Verluste seien nachvollziehbar mit nicht abgegrenzten Kosten beispielsweise aus der Teilnahme an Messen erläutert worden. Die Aufsichtsratsmitglieder hätten unter anderem darauf hingewiesen, dass der Schuldnerin das angekündigte frische Kapital zugeführt werden müsse, die Vorstandsgehälter für die Monate Mai und Juni 2007 gestundet, mit der V-Bank über eine Tilgungsaussetzung sowie mit einer Fima L. über Stundungsvereinbarungen verhandelt werden solle. Der Vorstand habe im Rahmen dieser Aufsichtsratssitzung indes mitgeteilt, dass sämtliche fälligen Verbindlichkeiten weiterhin beglichen würden, auch vor dem Hintergrund der aus der Liquiditätsvorschau (Anlage B 9) für Juni 2007 im Umfang von € 90.742,00 drohenden Unterdeckung sei dann die Anregung an den Vorstand zur Beauftragung eines Sanierungsgutachtens ergangen, der dieser auch nachgekommen sei. Erstmalig in der nachfolgenden außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 19. Juli 2007 (Protokoll als Anlage B 3.8 = B 11 = B 5/3) habe der Beklagte zu 1. vor dem Hintergrund, dass der als Investor interessierte Darlehensgeber mangels entsprechender finanzieller Mittel nicht mehr in der Lage gewesen sei, sein beabsichtigtes Engagement aufrechtzuerhalten, dann darauf hingewiesen, dass er bei fehlenden weiteren Geldmitteln vorsorglich Insolvenzantrag werde stellen müssen, und zugleich davon berichtet, dass teilweise fällige Verbindlichkeiten nicht bezahlt werden konnten. Der Aufsichtsrat habe dies zum Anlass genommen, den Vorstand mit Schreiben vom 20. Juli 2007 (Anlage B 3.9 = B 12 = B 5/8) zur Insolvenzantragstellung aufzufordern, und in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass Rechnungen keinesfalls mehr auch nur teilweise beglichen werden dürften.
Der Beklagte zu 5. hat darüber hinaus behauptet, er habe, was als solches unstreitig gewesen ist, wegen mehrerer Bandscheibenvorfälle krankheitsbedingt an keiner der vier in der Zeit vom 28. November 2006 bis zum 19. Juli 2007 durchgeführten Aufsichtsratssitzungen der Schuldnerin teilgenommen. Er habe sich aber gleichwohl fortlaufend über die Gegenstände der Aufsichtsratssitzungen unterrichten lassen.
Mit Urteil vom 28. Februar 2013 hat das Landgericht die Beklagten zu 1. und 2. wegen auf dem Konto der Schuldnerin bei der Sparkasse H. erfolgter Zahlungseingänge in Höhe von € 346.631,06 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25. Februar 2012 verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen.
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, dass die Schuldnerin spätestens seit dem 1. Februar 2007 zahlungsunfähig gewesen sei. Die spätestens zu diesem Zeitpunkt eingetretene Zahlungsunfähigkeit sei aufgrund der Zahlungseinstellung der Schuldnerin zu vermuten. Die Zahlungseinstellung ergebe sich vorliegend daraus, dass die Schuldnerin ausweislich der Insolvenztabelle bis zur Verfahrenseröffnung Verbindlichkeiten in Höhe von € 44.341,77 nicht mehr beglichen habe, die bereits am 1. Februar 2007 fällig gewesen seien. Diese Forderungen hätten auch einen wesentlichen Teil der fälligen Verbindlichkeiten dargestellt, da sich die per 1. März 2007 unerfüllt gebliebenen Verbindlichkeiten auf insgesamt € 87.740,01 belaufen hätten. Darüber hinaus ergebe sich die den Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin rechtfertigende Zahlungseinstellung der Schuldnerin zudem daraus, dass die Schuldnerin gegenüber der H a/s und der HL a/s Ratenzahlungen erbeten habe und derartige Bitten um Ratenzahlungen nach dem Klägervortrag auch gegenüber der M. GmbH und der P. GmbH erfolgt seien. Das Gesamtbild werde indiziell dadurch bekräftigt, dass das Betriebsergebnis der Schuldnerin stetig negativ verlaufen sei und nach der Insolvenztabelle die unbedient gebliebenen Verbindlichkeiten von € 87.740,01 per 1. März 2007 auf € 203.271,62 bis zum 1. Juli 2007 angestiegen seien.
Die Beklagten zu 1. und 2. hafteten hiernach auf die Erstattung der auf dem Konto der Schuldnerin bei der Sparkasse H. erfolgten Zahlungseingänge, die von ihnen nicht mit Substanz bestritten worden seien. Die Verpflichtung der Beklagten zu 1. und 2. als Vorstände der Schuldnerin sei auf die Masseerhaltung gerichtet gewesen und habe insoweit die Verpflichtung umfasst, Zahlungseingänge statt auf dem debitorischen Konto bei der Sparkasse H. auf ein kreditorisch geführtes Konto umzuleiten. Dass die Beklagten zu 1. und 2. dies versäumt hätten, sei auch nicht mit den an einen Geschäftsleiter in der Unternehmenskrise zu stellenden Sorgfaltsanforderungen zu vereinbaren, eine Aussicht auf eine kurzfristige Sanierung der Schuldnerin habe nicht bestanden, insoweit seien die Beklagten zu 1. und 2. von dem ihnen vorgeworfenen Versäumnis auch nicht exkulpiert. Einer Haftung auch für die auf dem Konto der Schuldnerin bei der V-Bank eingegangenen Zahlungen stünde demgegenüber die zu deren Gunsten erfolgte Globalzession entgegen.
Die Voraussetzungen einer Haftung auch der Beklagten zu 3. bis 5. lägen demgegenüber nicht vor. Zwar habe in der Unternehmenskrise auch der Aufsichtsrat die Verpflichtung, darauf hinzuwirken, dass der Vorstand verbotswidrige Zahlungen unterlasse. Insoweit unterliege der Aufsichtsrat Informations-, Beratungs- und Überwachungspflichten und müsse sich ein genaues Bild von der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft machen, die laufende Überwachung des Vorstands in allen Einzelheiten sei ohne Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Vorstands gleichwohl weder zu erwarten noch zulässig. Gemessen hieran habe der Kläger ein möglicherweise pflichtwidriges Verhalten der Beklagten zu 3. bis 5. aber schon nicht ausreichend dargelegt. Haftungsbegründend wären insofern bekannt gewordene Umstände gewesen, die dazu geführt hätten, dass die Beklagten zu 3. bis 5. die Zahlungseingänge auf dem Konto der Schuldnerin bei der Sparkasse H. hätten kontrollieren und deren Umleitung auf ein neutrales Konto hätten veranlassen müssen. Das sei indes nicht ausreichend dargetan. Dem Aufsichtsrat seien in dessen Sitzungen in der Zeit seit März 2006 keine Anhaltspunkte mitgeteilt worden, die eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nahe gelegt hätten. Es sei vielmehr unter anderem über mögliche Kooperationen und Beteiligungen berichtet worden, mit denen Kapitalzuflüsse verbunden gewesen wären, der Vorstand sei zudem dem an ihn gerichteten Wunsch nach fortlaufender Unterrichtung nachgekommen. Nach alledem habe es für den Aufsichtsrat keine Anhaltspunkte für eine bestehende oder drohende Insolvenzreife der Schuldnerin gegeben. Im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung vom 19. Juli 2007, in der von der Nichtzahlung fälliger Rechnungen berichtet worden sei, sei der Vorstand aufgefordert worden, sich hinsichtlich einer drohenden Insolvenz rechtlich beraten zu lassen und die Begleichung von Rechnungen zu unterlassen. Davon, dass der Vorstand dieser Aufforderung zuwider handeln würde, hätten die Beklagten zu 3. bis 5. nicht ausgehen müssen.
Gegen dieses ihm am 28. Februar 2013 zugestellte Urteil hat der Kläger am 28. März 2013 Berufung eingelegt, die er nach Fristverlängerung bis zum 27. Mai 2013 mit an diesem Tag eingegangener Berufungsbegründung begründet hat. Mit seiner Berufung verfolgt der Kläger seinen erstinstanzlichen Klageantrag gegenüber allen fünf Beklagten unverändert weiter.
Der Kläger macht geltend, das Landgericht habe unzutreffend festgestellt, dass die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin erst zum 1. Februar 2007 eingetreten sei. Tatsächlich sei im Hinblick auf die unterbliebene Zahlung der Geschäftsraummieten für April und Mai 2006 von einer bereits spätestens im Juni 2006 eingetretenen Zahlungsunfähigkeit auszugehen. Darüber hinaus habe es das Landgericht zu Unrecht dahinstehen lassen, ob bei der Schuldnerin auch eine Überschuldung eingetreten sei. Tatsächlich sei, insoweit wiederholt der Kläger sein erstinstanzliches Vorbringen, von einer ebenfalls bereits spätestens zum 1. Februar 2007 eingetretenen Überschuldung der Schuldnerin auszugehen. Das per 31. Januar 2006 noch im Umfang von lediglich € 14.000,00 verbliebene positive Eigenkapital der Schuldnerin sei bereits nach dem 1. Quartal des am 1. Februar 2006 begonnenen neuen Geschäftsjahrs aufgebraucht gewesen.
Der Kläger macht ferner geltend, dass eine Haftung der Beklagten auch hinsichtlich der Zahlungseingänge der Schuldnerin bei der V-Bank bestünde. Die Verpflichtung der Beklagten zu 1. und 2. zur Massesicherung sei durch die – gegenüber den Drittschuldnern auch nicht offengelegte – Abtretung von Forderungen der Schuldnerin an die V-Bank nicht eingeschränkt worden, ungeachtet dieser Abtretung hätten die Beklagten zu 1. und 2. die tatsächliche Möglichkeit gehabt, die Zahlungen für die Schuldnerin auf einem kreditorisch geführten Bankkonto zu vereinnahmen. Es habe auch keine Absprachen der Schuldnerin mit der V-Bank gegeben, auf deren Grundlage die Schuldnerin etwa dazu verpflichtet gewesen wäre, den Forderungseinzug ausschließlich über das dort unterhaltene Konto durchzuführen. Dies zeige sich schon daran, dass die Schuldnerin Teile ihrer Forderungen tatsächlich auch über ihr bei der Sparkasse H. geführtes Konto eingezogen habe. Ohnehin wäre die Verpflichtung der Beklagten zu 1. und 2. zur Massesicherung gegenüber einer etwaigen Verpflichtung zur Vornahme des Forderungseinzugs ausschließlich über das bei der V-Bank geführte Konto höherwertig gewesen. Mit einem zulässigen Forderungseinzug auf ein anderes Konto als dasjenige bei der V-Bank wäre deren Sicherungsrecht erloschen und die Masse bezogen auf diese Forderungen zu Gunsten der Gläubigergesamtheit erhalten worden. Auf die Insolvenzfestigkeit der zu Gunsten der V-Bank erfolgten Sicherungsabtretung komme es entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht an, jedenfalls die ab dem 10. Mai 2007 eingezogenen Forderungen hätten aber schon deshalb nicht insolvenzfest sein können, weil diese Forderungen erst innerhalb des Zeitraums von drei Monaten vor dem Insolvenzantrag werthaltig gemacht worden seien. Das Landgericht habe in diesem Zusammenhang auch verkannt, dass der Forderungseinzug auf das Konto der Schuldnerin bei der V-Bank insbesondere der Entlastung der Beklagten zu 1. und 2. und deren Ehefrauen von den gegenüber der V-Bank bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen gedient habe und insofern die Gläubigergesamtheit auf wertlose Ansprüche aus §§ 32a, 32b GmbHG, 135 InsO verwiesen worden sei.
Hinsichtlich der Inanspruchnahme der Beklagten zu 3. bis 5., die jeweils Kenntnis unter anderem davon gehabt hätten, dass die Konten der Schuldnerin bei der Sparkasse H. und der V-Bank debitorisch geführt worden seien, habe das Landgericht die Haftungsvoraussetzungen zu Unrecht zu eng angesetzt. Soweit das Landgericht angenommen habe, dass die Beklagten zu 3. bis 5. ihre Überwachungstätigkeit intensiviert und ihren Sorgfaltspflichten hierdurch genügt hätten, habe das Landgericht übersehen, dass die Beklagten zu 3. bis 5. in der ihnen ebenfalls bekannt gewordenen Unternehmenskrise tatsächlich überhaupt nichts unternommen hätten. Allein mit intensivierten Sitzungen und Kontakten hätten die den Beklagten zu 3. bis 5. obliegenden Pflichten in der verschärften Krise der Schuldnerin jedenfalls nicht erfüllt werden können. Den Beklagten zu 3. bis 5. seien ausweislich des Lageberichts des Vorstands zum geprüften Jahresabschluss zum 31. Januar 2006 die nahezu vollständige Aufzehrung des Eigenkapitals und der Umsatzeinbruch der Schuldnerin sowie die hieraus resultierende Unternehmenskrise ebenso bekannt gewesen wie der im nachfolgenden Geschäftsjahr sich fortsetzende Umsatzrückgang. Die Prüfung des Jahresabschlusses habe zudem einen im Umfang von € 481.000,00 negativen Cash-Flow bei der Schuldnerin ausgewiesen, der den Beklagten zu 3. bis 5. ebenfalls die zumindest drohende Zahlungsunfähigkeit aufgezeigt habe.
Das Protokoll der am 28. November 2006 durchgeführten Aufsichtsratssitzung (Anlage B 3.4 = B 4 = B 5/3) habe wiederum aufgezeigt, dass unter anderem die finanzielle Situation der Schuldnerin unverändert stark angespannt gewesen und weitere Verluste erwirtschaftet worden seien. Hieraus hätte es sich den Beklagten zu 3. bis 5. aufdrängen müssen, dass die im geprüften Jahresabschluss per 31. Januar 2006 vorgesehene Veränderung der Geschäftspolitik, insbesondere hinsichtlich der Vermarktung zusätzlicher Produktlinien, gescheitert gewesen sei. Die im Rahmen dieser Aufsichtsratssitzung vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen hätten per November 2006 zudem einen € 14.000,00 übersteigenden Verlust ausgewiesen, woraus sich erkennbar der Eintritt der Überschuldung ergeben habe.
In dieser Situation seien die Beklagten zu 3. bis 5. verpflichtet gewesen, gegenüber den Beklagten zu 1. und 2. auf die Einrichtung eines Überwachungssystems gemäß § 91 Abs. 2 AktG zu drängen und zusätzlich darauf, dass die Beklagten zu 1. und 2. eine ständige Prüfung des Vorliegens von Insolvenzgründen vornehmen und den Aufsichtsrat hierüber unterrichtet hielten. Die Beklagten zu 3. bis 5. hätten sich insofern nicht auf die bloße Behauptung der Beklagten zu 1. und 2. verlassen dürfen, dass eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin nicht vorliege, sondern das Ergebnis einer entsprechenden Prüfung durch die Beklagten zu 1. und 2. zumindest ihrerseits auf Plausibilität prüfen müssen. Namentlich hätten die Beklagten zu 3. bis 5. im Hinblick auf die bereits in dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Januar 2006 (Anlage K 6) angesprochene Liquiditätskrise der Schuldnerin beaufsichtigen müssen, dass die Beklagten zu 1. und 2. bei jeder Zahlung die mögliche Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin prüfen. Tatsächlich sei eine derartige Prüfung der Zahlungsunfähigkeit aber zu keinem Zeitpunkt erfolgt.
Der Kläger beantragt,
unter Abänderung des am 28. Februar 2013 verkündeten Urteils des Landgerichts Hamburg, Aktenzeichen 413 HKO 40/12, werden die Beklagten zu 1. bis 5. als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger € 1.335.109,05 nebst 5% Punkte Zinsen über dem Basiszinssatz zu zahlen.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagten zu 1. und 2. verteidigen das angefochtene Urteil.
Die Beklagten zu 3. bis 5. wenden sich gegen die Annahme des Landgerichts, es sei bei der Schuldnerin ab dem 1. Februar 2007 von einer Zahlungsunfähigkeit auszugehen. Soweit das Landgericht eine Zahlungseinstellung der Schuldnerin aus den zur Insolvenztabelle angemeldeten Forderungen der H.-Gruppe hergeleitet habe, habe es verkannt, dass diese mit der Schuldnerin ein Verrechnungskonto geführt habe, das nicht geklärt gewesen sei und nach entsprechender Abstimmung zu der im Juli 2007 zustande gekommenen Ratenzahlungsvereinbarung geführt habe. Auch den mit der M. GmbH und der P. GmbH geführten Stundungsvereinbarungen habe zu Grunde gelegen, dass hinsichtlich der tatsächlichen Forderungshöhe Klärungsbedarf bestanden habe. Die Beklagten zu 3. bis 5. halten im Übrigen daran fest, dass ihnen Einzahlungen auf das nach den Behauptungen des Klägers fortlaufend debitorisch geführte Konto der Schuldnerin bei der Sparkasse H. nicht bekannt und auch nicht erkennbar gewesen seien. Im Übrigen überspanne der Kläger die an den Aufsichtsrat eines kleinen familiengeführten Unternehmens in der Krise zu stellenden Überwachungspflichten ganz erheblich.
II.
Die zulässige Berufung ist unbegründet.
1.a) Der vom Kläger gegenüber den Beklagten mit der Berufung weiterverfolgte Anspruch gemäß §§ 92 Abs. 3 Satz 1 [a.F.], 93 Abs. 3 Nr. 6 [a.F.], 116 Satz 1 [a.F.] AktG auf Ersatz in der Zeit vom 1. Februar bis zum 12. September 2007 auf die Konten der Schuldnerin bei der Sparkasse H. und bei der V-Bank erfolgter Einzahlungen besteht nicht.
aa) Dem Kläger ist zwar im rechtlichen Ausgangspunkt insoweit zu folgen, als dass für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung der Gesellschaft die Entgegennahme von Zahlungen auf ein debitorisch geführtes Konto eine verbotene Zahlung im Sinne des § 93 Abs. 3 Satz 1 [a.F.] AktG darstellen kann. Dies rechtfertigt sich daraus, dass durch einen Zahlungseingang auf einem debitorischen Konto das Aktivvermögen der Gesellschaft zu Lasten ihrer Gläubigergesamtheit (und zum Vorteil der Bank) in gleicher Weise geschmälert wird wie bei einer Auszahlung aus dem Barvermögen der Gesellschaft (BGH Urt. v. 26. März 2007 – II ZR 310/05 -, ZIP 2007, 1006 ff., juris Rn. 12). In beiden Fällen wird der Insolvenzmasse zugunsten der Befriedigung eines Gläubigers ein Betrag entzogen, der anderenfalls zur (teilweisen) Befriedigung aller Insolvenzgläubiger zur Verfügung stünde (BGH, Urt. v. 29. November 1999 – II ZR 273/98 -, BGHZ 143, 184 ff., juris Rn. 9).
bb) Demgegenüber ist vorliegend aber schon auf der Grundlage des eigenen Vorbringens des Klägers und des unstreitigen Vorbringens der Beklagten davon auszugehen, dass die Insolvenzmasse durch die klagegegenständlichen Einzahlungen auf die betreffenden Konten der Schuldnerin nicht geschmälert worden ist. Sämtliche Forderungen gegenüber Drittschuldnern der Schuldnerin waren nämlich bereits durch die Globalabtretungsvereinbarung vom 26. Mai 2005 an die V-Bank abgetreten, standen der Schuldnerin hiernach rechtlich und mit Rücksicht auf deren gegenüber der V-Bank bestehende Verbindlichkeiten auch wirtschaftlich nicht mehr zu und konnten damit schon vor den jeweiligen Zahlungsvorgängen nicht mehr Bestandteil des der Verpflichtung zum Masseerhalt unterliegenden Vermögens der Schuldnerin sein.
(1) Die Haftung gemäß §§ 93 Abs. 2 Nr. 6 AktG, 64 GmbHG, 130a Abs. 1 HGB setzt aber eine Masseschmälerung, einen Abfluss von Mitteln aus der im Stadium der Insolvenzreife der Gesellschaft zugunsten der Gesamtheit ihrer Gläubiger zu erhaltenden Vermögensmasse, voraus (BGH, Urt. v. 18. November 2014 – II ZR 231/13 -, ZIP 2015, 71 ff., juris Rn. 9, 10). Da die gegenüber Drittschuldnern bestehenden Forderungen nicht Teil des geschützten Aktivvermögens der Schuldnerin waren, waren die Beklagten zur Vermeidung einer Inanspruchnahme aus §§ 92 Abs. 3 Satz 1 [a.F.], 93 Abs. 3 Nr. 6 [a.F.], 116 Satz 1 [a.F.] AktG dementsprechend auch nicht gehalten, die Globalabtretung zu Gunsten der V-Bank dadurch zu unterlaufen, dass sie die dieser zustehenden Forderungen auf ein neu eröffnetes, kreditorisch geführtes Bankkonto der Schuldnerin einzogen (Strohn, NZG 2011, 1161 ff., 1166; Rowedder/Schmidt-Leithoff/Baumert, GmbHG, 5. Aufl. 2013, § 64 Rn. 33). Hierdurch hätte eine Masseverkürzung nämlich nicht verhindert, sondern allenfalls eine Massebereicherung herbeigeführt werden können, der das „Zahlungsverbot“ des § 92 Abs. 3 Satz 1 [a.F.] AktG indes nicht dient (BGH, a.a.O. Rn. 11 a.E.).
(2) Vorliegend hätte eine Vergrößerung des Aktivvermögens der Schuldnerin durch den Einzug von Forderungen auf einem kreditorisch geführten Bankkonto allerdings schon deshalb nicht herbeigeführt werden können, weil es sich bei den hierdurch begründeten Auszahlungsansprüchen der Schuldnerin gegenüber der kontoführenden Bank ebenfalls um Ansprüche gehandelt hätte, die wiederum von der auf „sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus dem Geschäftsverkehr, insbesondere aus Lieferungen und Leistungen“ gerichteten Globalabtretung zu Gunsten der V-Bank umfasst gewesen wären (OLG Frankfurt, Urt. v. 15. Juli 2009 – 4 U 298/08 -, ZIP 2009, 2293 ff., juris Rn. 18 f., und nachfolgend BGH, Urt. v. 25. Januar 2011 – II ZR 196/09 -, ZIP 2011, 422 ff., juris Rn. 3, 21).
(3) Eine im Rahmen der §§ 92 Abs. 3 Satz 1 [a.F.], 93 Abs. 3 Nr. 6 [a.F.], 116 Satz 1 [a.F.] AktG haftungsbegründend vorauszusetzende Masseschmälerung lässt sich schließlich auch nicht damit begründen, dass der Kläger im Falle des Forderungseinzugs auf ein kreditorisches Bankkonto der Schuldnerin gemäß §§ 170, 171 InsO Kostenbeiträge hätte erheben können. Die in § 171 InsO genannten Kostenbeiträge sollen allein dazu dienen, die Insolvenzmasse von den Kosten zu entlasten, die, soweit ein Absonderungsrecht geltend gemacht wird, für die Feststellung der Rechtslage sowie für die Verwertung der Gegenstände anfallen (BGH, Urt. v. 25. September 2014 – IX ZR 156/12 -, ZIP 2014, 2305 ff., juris Rn. 11; Urt. v. 20. November 2003 – IX ZR 259/02 -, ZIP 2004, 42 ff., juris Rn. 14; Urt. v. 9. Oktober 2003 – IX ZR 28/03 -, ZIP 2003, 2370 ff., juris Rn. 16).
cc) Anhaltspunkte für eine Unwirksamkeit der zu Gunsten der V-Bank vereinbarten Globalabtretung zeigt der Kläger nicht auf, diese sind auch sonst nicht ersichtlich. Namentlich ist auch eine Übersicherung der V-Bank nicht zu erkennen. Hiergegen spricht schon, dass innerhalb des klagegegenständlichen Zeitraums nach dem eigenen Vorbringen des Klägers mit der Klageschrift unbeschadet der auf das Konto der Schuldnerin bei der V-Bank erfolgten Einzahlungen dessen Sollsaldo den Betrag von zuletzt € 313.128,99 zu Lasten der Schuldnerin zu keinem Zeitpunkt unterschritten hat.
Auch für eine Anfechtbarkeit der zu Gunsten der V-Bank erfolgten Globalabtretung ist nichts ersichtlich. Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang mit der Berufung geltend macht, jedenfalls die ab dem 10. Mai 2007 eingezogenen Beträge seien als Forderungen anzusehen, die erst innerhalb des Drei-Monatszeitraums vor dem Insolvenzantrag werthaltig geworden seien und deshalb gemäß § 130 Abs. 1 InsO einer Anfechtung als kongruente Deckung unterlegen hätten (vgl. BGH, Urt. v. 26. Juni 2008 – IX ZR 144/05 -, ZIP 2008, 1435 ff., juris Rn. 17; Urt. v. 29. November 2007 – IX ZR 30/07 -, BGHZ 174, 297 ff., juris Rn. 35, 38; Urt. v. 29. November 2007 – IX ZR 165/05 -, ZIP 2008, 372 ff., juris Rn. 12, 14 f.), fehlt es an jeglichem Vorbringen des Klägers zu den den klagegegenständlichen Einzahlungen zu Grunde liegenden Einzelforderungen, anhand dessen diese Behauptung nachzuvollziehen sein könnte.
b) Auch soweit der Kläger sich hinsichtlich der Inanspruchnahme der Beklagten zu 1. und 2. zugleich auf §§ 32a [a.F.], 32b [a.F.] GmbHG, 135 InsO stützt und hierzu geltend macht, durch den Forderungseinzug auf das Konto der Schuldnerin bei der V-Bank seien deren Ehefrauen und sie selbst von den dieser gegenüber eingegangenen Bürgschaftsverpflichtungen entlastet worden, rechtfertigt dies eine auch nur teilweise Abänderung des angefochtenen Urteils zu Gunsten des Klägers nicht. Der Kläger verkennt in diesem Zusammenhang, dass die Beklagten zu 1. und 2. unstreitig nicht Aktionäre der Schuldnerin waren und dieser gegenüber insofern auch keiner Finanzierungsfolgenverantwortung unterlagen (BGH, Urt. v. 9. Mai 2005 – II ZR 66/03 -, ZIP 2005, 1316 ff., juris Rn. 10).
c) Gegenüber den Beklagten zu 3. bis 5. erweist sich die Berufung zudem aber auch schon deshalb als unbegründet, weil nicht festzustellen ist, dass es durch die diesen vorgeworfenen Pflichtverletzungen zu einem Vermögensverlust der Schuldnerin im Sinne des § 93 Abs. 3 Nr. 6 [a.F.] AktG gekommen wäre. Der Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Vermögensverlust unterliegt als Element der haftungsbegründenden Kausalität aber der Darlegungs- und Beweispflicht des Klägers (BGH, Urt. v. 16. März 2009 – II ZR 280/07 -, ZIP 2009, 860 ff., juris Rn. 16)
aa) Auf der Grundlage des Berichts des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses der Schuldnerin zum 31. Januar 2006 (Anlage K 6) sowie der Protokolle der nachfolgenden Aufsichtsratssitzungen ist zwar davon auszugehen, dass die Unternehmenskrise auch den Beklagten zu 3. bis 5. als den Aufsichtsratsmitgliedern der Schuldnerin nicht entgangen ist. Hiernach unterlagen die Beklagten zu 3. bis 5. nicht zuletzt auch hinsichtlich des vom Vorstand einzuhaltenden Zahlungsverbots gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 [a.F.] AktG einer gesteigerten Überwachungspflicht, in deren Rahmen sie auch dazu verpflichtet waren, sich ein genaues Bild von der wirtschaftlichen Situation der Schuldnerin zu machen und insoweit die ihnen nach §§ 90 Abs. 3, 111 Abs. 2 AktG zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen auszuschöpfen (BGH, a.a.O. Rn. 15).
Es lässt sich aber nicht feststellen, dass die Beklagten zu 3. bis 5. durch die Wahrnehmung ihrer hinsichtlich der Bücher und Schriften der Schuldnerin bestehenden Einsichtnahme- und Prüfungsrechte eine nicht nur drohende, sondern bereits eingetretene Insolvenzreife der Schuldnerin mit der Konsequenz hätten erkennen können, dass die ihnen obliegenden Informations-, Beratungs- und Überwachungspflichten sich zu einer Verpflichtung dahingehend verdichtet hätten, darauf hinzuwirken, dass der Vorstand keine mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters nicht zu vereinbarenden Zahlungen mehr leiste (BGH, Urt. v. 20. September 2010 – II ZR 78/09 -, BGHZ 187, 60 ff., juris Rn. 13; Urt. v. 16. März 2009, a.a.O.) bzw. insofern auch keine Zahlungen auf etwa debitorisch geführte Bankkonten der Schuldnerin mehr entgegennehme.
bb) Für den Fall, dass die Beklagten zu 3. bis 5. die Geschäftsunterlagen der Schuldnerin unter dem Gesichtspunkt der bereits eingetretenen Insolvenzreife einer pflichtgemäß eigenständigen Prüfung unterzogen hätten, hätte zunächst eine das Zahlungsverbot des § 92 Abs. 3 Satz 1 [a.F.] auslösende Überschuldung der Schuldnerin nämlich deshalb nicht festgestellt werden können, weil von einer Überschuldung der Schuldnerin wiederum schon auf der Grundlage des eigenen Vorbringens des Klägers und des unstreitig gebliebenen Vorbringens der Beklagten tatsächlich nicht auszugehen ist.
Im Rahmen der von ihm behaupteten Überschuldung der Schuldnerin hat der Kläger die seitens der Beklagten unbestritten im Umfang von zumindest € 328.000,00 geltend gemachten Rangrücktrittserklärungen unter anderem der beiden Aktionärinnen der Schuldnerin mit den ihnen dieser gegenüber zustehenden Darlehensforderungen schlicht unberücksichtigt gelassen. Bei deren zutreffender Berücksichtigung hat sich eine Überschuldung der Schuldnerin im klagegegenständlichen Zeitraum aber bereits deshalb nicht ergeben können, weil die in einem Überschuldungsstatus zu bilanzierenden Verbindlichkeiten der Schuldnerin in diesem Fall um eben diesen Betrag geringer anzusetzen gewesen wären mit der Folge, dass entgegen dem Vorbringen des Klägers weder per 1. Februar 2007 von einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 42.101,11 oder gar € 166.091,52 noch per 30. April 2007 von einem weiteren Fehlbetrag der Schuldnerin in Höhe von € 148.661,63 auszugehen gewesen wäre. Soweit der Kläger eine Überschuldung der Schuldnerin im Umfang von mindestens € 527.450,05 zudem daraus herleitet, dass deren Warenbestand in einem Überschuldungsstatus mit höchstens € 500.000,00 anzusetzen gewesen wäre, ermangelt es dem Vorbringen des Klägers jeglicher Substantiierung, auf deren Grundlage dieser Wertansatz nachvollzogen werden könnte.
cc) Es ist zugleich aber ebenso wenig festzustellen, dass die Beklagten zu 3. bis 5. für den Fall der pflichtgemäßen Wahrnehmung ihrer hinsichtlich der Geschäftsunterlagen der Schuldnerin bestehenden Einsichtnahmerechte deren bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit hätten feststellen können. In diesem Zusammenhang gilt, dass auch der Kläger sich für die von ihm behauptete Zahlungsunfähigkeit (§ 17 Abs. 2 Satz 1 InsO) der Schuldnerin nicht etwa auf eine aus den Geschäftsunterlagen der Schuldnerin abgeleitete Liquiditätsbilanz, also eine stichtagsbezogene Gegenüberstellung der fälligen Verbindlichkeiten und der liquiden Mittel der Schuldnerin, stützt, sondern sich stattdessen lediglich auf solche Umstände bezieht, die eine Zahlungseinstellung und die hieraus gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO zu schlussfolgernde Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin indiziell nahelegen.
(1) Soweit der Kläger die Zahlungsunfähigkeit aus angeblich eigenen Erklärungen der Schuldnerin ableitet, ihre bestehenden Verbindlichkeiten nicht vollständig erfüllen zu können, kommt derartigen Äußerungen, auch wenn sie mit einer Stundungsbitte verbunden sind, zwar regelmäßig eine erhebliche Bedeutung für die Frage der Zahlungseinstellung zu (BGH, Versäumnisurt. v. 10. Juli 2014 – IX ZR 280/13 -, ZIP 2014, 1887 ff., juris Rn. 28). Derartige eigene Erklärungen der Schuldnerin lassen sich den seitens des Klägers insoweit in Bezug genommenen Schriftstücken indes nicht entnehmen. Weder die beiden insoweit herangezogenen Schreiben der A. KG (Anlagen K 2 und K 2a), noch die von der M. GmbH erstellten Schriftstücke (Anlagen K 3 und K 4) und auch nicht die E-Mail-Korrespondenz des Beklagten zu 1. mit der P. GmbH (Anlage K 5) sind für eine angebliche Erklärung der Schuldnerin, zur Erfüllung diesen Gläubigern gegenüber bestehender Verbindlichkeiten nicht in der Lage zu sein, indiziell aussagekräftig. Dieser Korrespondenz lässt sich vielmehr lediglich entnehmen, dass die Schuldnerin um Ratenzahlungen nachgesucht hat. Dies allein lässt den Schluss auf eine Zahlungseinstellung für sich genommen aber noch nicht zu.
Von inhaltlich darüber hinausgehenden, etwa bloß mündlichen Erklärungen des Vorstands der Schuldnerin gegenüber deren Gläubigern, zur Erfüllung fälliger Verbindlichkeiten nicht in der Lage zu sein, hätten die Beklagten zu 3. bis 5. demgegenüber aber auch durch die Wahrnehmung ihrer gemäß § 111 Abs. 2 AktG auf die Geschäftsunterlagen der Schuldnerin bezogenen Einsichtnahmerechte noch keine Kenntnis erlangen können.
(2) Auch die aus der Nichtzahlung fälliger und bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens unbeglichen gebliebener Verbindlichkeiten für die Beurteilung der Zahlungseinstellung abzuleitende Indizwirkung (BGH, Urt. v. 19. November 2013 – II ZR 229/11 -, ZIP 2014, 168 ff., juris Rn. 21; Versäumnisurt. v. 24. Januar 2012 – II ZR 119/10 -, ZIP 2012, 723 ff., juris Rn. 13) müssen sich die Beklagten zu 3. bis 5. vorliegend nicht entgegenhalten lassen.
Zu den klägerseitig behaupteten Zeitpunkten des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin hat sich aus deren Geschäftsunterlagen naturgemäß kein Anhaltspunkt dafür entnehmen lassen können, welche der jeweils aktuell bestehenden Verbindlichkeiten auch noch bis zur Eröffnung eines zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal beantragten Insolvenzverfahrens von der Schuldnerin zukünftig nicht mehr erfüllt werden würden. Der bloße Umstand, das die Schuldnerin zu den Zeitpunkten des seitens des Klägers behaupteten Eintritts der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin überhaupt fälligen Verbindlichkeiten ausgesetzt gewesen ist, hat aus der maßgeblichen damaligen Sicht der Beklagten zu 3. bis 5. für die Beurteilung einer bereits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit für sich genommen aber so lange noch nichts hergeben können, wie nicht zugleich festgestanden hat, dass diese Verbindlichkeiten innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen zu mehr als zehn Prozent nicht mehr hätten erfüllt werden können (BGH, Urt. v. 24. Mai 2005 – IX ZR 123/04 -, BGHZ 163, 134 ff., juris Rn. 29 ff.). Dass dies der Fall gewesen wäre und zugleich die Beklagten zu 3. bis 5. dies den Geschäftsunterlagen der Schuldnerin hätten entnehmen können, lässt sich aber schon auf der Grundlage des eigenen Vorbringens des Klägers wiederum nicht feststellen.
Hiernach kommt auch insbesondere der Behauptung des Klägers keine ausschlaggebende Bedeutung für die Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit zu, dass die Schuldnerin gegenüber ihrer Vermieterin bereits im Frühjahr 2006 mit lediglich zwei Monatsmieten in Rückstand geraten und nachfolgend geblieben ist. Dass diesem Sachverhalt nicht die Bedeutung einer Zahlungseinstellung hat zukommen können, erschließt sich nämlich schon daraus, dass die Zahlung der laufenden Monatsmieten von der Schuldnerin nachfolgend wieder uneingeschränkt aufgenommen worden ist.
(3) Soweit mit – nicht nachgelassenem – Schriftsatz vom 16. Februar 2015 der Kläger die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin erstmals auch aus in dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Januar 2006 ausgewiesenen Liquiditätskennzahlen der Schuldnerin herleitet, haben die Beklagten zu 3. bis 5. den Schluss auf eine bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit hieraus schon mit Blick darauf nicht ziehen müssen, dass die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin in diesem Prüfbericht (Anlage K 6, dort S. 15) demgegenüber sogar ausdrücklich positiv festgestellt worden ist.
2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 709 Satz 2, 711 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO für die Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts.
(Quelle: http://openjur.de/u/767492.html)